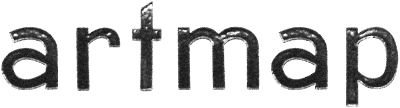"STÖRUNGEN VON OBERFLÄCHE - BETRACHTUNGEN ZU DANIEL LERGON AUSSTELLUNG „IAPETUS“ IM KUNSTVEREIN MÖNCHENGLADBACH" VON ANDREW CANNON
Im Oktober 1671 entdeckte der franko-italienische Astronom Giovanni Domenico Cassini westlich des Saturns einen Mond, der fast gänzlich aus Eis besteht. Der Mond ist insofern einzigartig, als er sowohl eine dunkle als auch eine helle Hemisphäre besitzt. Dies irritierte Cassini als er einige Monate nach seiner ersten Observation versuchte, den Mond östlich des Saturn auszumachen. Erst 1705, mehr als dreißig Jahre später, sollte es Cassini gelingen, mithilfe eines fortschrittlicheren Teleskops den Mond östlich des Saturns zu beobachten.
Dies ließ den Astronomen folgerichtig schließen, dass der kraterübersäte Mond in gebundener Rotation um seinen Mutterplaneten kreist, wobei er immer mit derselben Seite zum Saturn weist. Man nimmt an, dass der silberweiße Mond im Laufe der Zeit mit Meteoren von kleinen äußeren Monden kollidierte, die sich in retrograden Umlaufbahnen bewegten. Trümmer und Staub dieser Kollisionen stürzten auf die führende Hemisphäre des Mondes, die aufgewirbelt wurde. Dabei wurde die makellose Eiskruste des Mondes „befleckt“ und es entstand etwas, das man fast als „beschmutzten Mond“ bezeichnen könnte. Für diese dunkel gezeichnete Region errechnete Cassini ein um zwei Grad dunkleres Helligkeitsmaß als das der anderen, helleren Hemisphäre des Mondes – der Grund auch dafür, dass sie von der Erde aus kaum zu beobachten war. Mehr als ein Jahrhundert später, im Jahr 1847, schlug der britische Mathematiker und Astronom John Herschel vor, die Saturnmonde nach den zwölf Titanen aus der griechischen Mythologie zu benennen. So bekam Cassinis Entdeckung endlich ihren Namen: Iapetus.
Daniel Lergons Einzelausstellung im Kunstverein Mönchengladbach ist nach eben diesem ungewöhnlichen und einzigartigen Mond benannt und es überrascht nicht, dass Iapetus als Sujet in der Sphäre dieses Künstlers auftaucht. Der Begriff Albedo – das Maß für die Lichtreflektion eines nicht selbstleuchtenden Objektes – wird häufig im Zusammenhang mit Materie angewandt, die das ganze Lichtspektrum von Hell zu Dunkel wiedergibt. Er gab 2007 einer Ausstellung Lergons in der Galerie Andreas Huber, Wien, den Titel. Dort zeigte er riesige runde Gemälde, die einander gegenüber positioniert waren und so den Eindruck einer Doppeleklipse vermittelten. Auf der einen Arbeit lässt eine weiße Wolke eine indigoblaue Sichel sichtbar werden. Auf der anderen ist fast die gesamte Bildfläche von einem dunklen Erdton bedeckt, der nur am linken Rand einer dünnen, hellsilbrigen Sichel Raum gibt. Iapetus mit seiner hellen und dunklen Hemisphäre ist ein Musterbeispiel für die Albedo: Inspiration und strukturierendes Element für Lergons Arbeiten der Ausstellung im Kunstverein Mönchengladbach.
Betritt man das Erdgeschoss des Ausstellungsraums, so wird man mit einer riesigen Wandmalerei konfrontiert, die fast die ganze Horizontale der Oberfläche bedeckt und aus Graugusspulver besteht. Mit diesem Material wurde auf die nackte Wand gemalt, eine Vorgehensweise, die an Lergons Ausstellung „Elements“ in der Galerie Almine Rech in Brüssel erinnert. Der Begriff Elements spielte dort auf die Metallpulver an, aus denen die Arbeiten der Ausstellung geschaffen wurden. In der Ausstellung in Mönchengladbach nutzte Lergon ein ähnliches Material, um die Architektur zu markieren. Dabei bezieht er sich auf die befleckte schwarze Hemisphäre des Iapetus und die Staubspuren, die der Kontakt mit dem kosmischen Abfall hinterlassen hat. Bemerkenswert ist hier die Tatsache, dass das graue Eisen, das in pulverisierter Form zur Bemalung der Wand diente, auch ein Bestandteil von Meteoren sein kann. Die Wandbemalung selbst erinnert an einen Meteor, da Lergon die metallische Verbindung zu einer stumpfen, felsbrockenartigen Form verdichtet hat, die in großer Dynamik nach oben hin gasförmig zu werden scheint. Durch Lergons Pinselführung scheint dieser Auflösungsprozess durch eine Art Vakuum nach links gesogen zu werden, wobei eine dunkle, feine Spur verbleibt, die sich über das gesamte Weiß der Wand zieht. Bei der Betrachtung dieser dynamischen Arbeit scheint man Zeuge einer rasanten Animation zu werden, die den Moment kurz vor der Verwandlung von Materie andeutet. Wir assoziieren einen Wandel zwischen stabilen und instabilen Zuständen, zwischen Feuchtigkeit und Luft sowie von Materie, die durch äußere Einflüsse Transformationen unterworfen wird, Temperaturänderungen bis hin zu gewaltigem Druck, der Objekte verformt und sie in Struktur und Gestalt verändert. Hier wird Lergons Interesse an Astrophysik evident. Der Kanon der Entstehung unseres Sonnensystems, bestehend aus Begriffen wie Ausdehnung, Explosion, Dichte, Wärme, Abkühlung und Beschleunigung, wird durch Lergons Markierungen in einem Prozess gefiltert, den man als im Verlauf der Zeit sich verfestigende Geste bezeichnen könnte.
Ein wichtiger Teil der Entstehungsgeschichte unseres Universums betrifft die Trennung von Strahlung und Materie und damit die Entstehung des Lichtspektrums. Die Idee, dass Teilchen bei der Entstehung von Licht eine Rolle spielen, leitet uns metaphorisch über in die obere Ebene der Ausstellung, in der Lergon eine Serie von Bildern präsentiert, die auf für technische Zwecke entwickeltem, retroreflexivem Material gearbeitet sind. Dieses speziell produzierte Material ist insofern einzigartig, als dass es Licht in die Richtung reflektiert, aus der es ausgestrahlt wird. Frühe Mondfahrzeuge, die sich über die Oberfläche des Mondes bewegten, konnten während ihrer Exkursionen anhand von Lichtstrahlen, die durch die Kontrollteams auf Retroreflektoren an ihren Chassis gerichtet wurden, exakt lokalisiert werden. Die Eigenschaft der Retroreflexivität, Licht auf demselben Strahl zu seiner Quelle zurückzusenden, lässt im Zusammenhang mit Lergons Arbeiten an Positionierung und Bezugnahme denken. Es ist nicht das erste Mal, dass Lergon auf diesem Malgrund arbeitet. 2008 präsentierte er in seiner Ausstellung „States of Matter“ in der Galerie Andersens’s Contemporary in Berlin riesige retroreflexive Arbeiten, die mit Lack in gewundenen, gleichsam suchenden Formen bemalt waren.
Die schimmernde Reihe von fünf weißen, retroreflexiven Arbeiten im oberen Geschoss des Kunstvereins Mönchengladbach fesselt den Betrachter auf intimere Weise. Hier findet sich die helle Hemisphäre der Iapetus-Ausstellung, in der Lergon die Untergründe mit farblosem Lack bemalt hat. Das Licht wird von der verfestigten, durchsichtigen Oberfläche physikalisch abgelenkt. Lergon vergleicht die Art und Weise, in der er den Lack auf die Oberfläche aufträgt, mit einer Art „Tanz“, was an eine Choreografie denken lässt, in der der Maler eine Reihe von Bewegungskomponenten auf das Material überträgt. „Tanz“ wird auch für die Beziehung des Künstlers zu dem Werk in seiner Gesamtheit relevant. Lergon bewegt sich horizontal über den flach auf dem Boden liegenden Malgrund und reagiert in seiner Bewegung auf den Lack, der entweder fließt oder quasi statisch bleibt, wobei sich der Künstler jedoch stets durch die Wirkung des Lichts leiten lässt. Diese Herangehensweise verleiht der Arbeit ihre Dynamik.
In seinem Essay „Painting Potentials, Enframing Perception“ lenkt Gregory Carlock das Augenmerk auf einen “Eigenraum”, der die Oberflächen von Lergons Gemälden umgibt und sich wie ein Konus von der flachen Bildoberfläche zum Betrachter hin erstreckt. Carlock erläutert auch, dass die Gestaltung dieses „Volumens“ Lergon möglicherweise wichtiger ist als eine nur auf das Malen selbst bezogene Arbeit. Ganz sicher begreift Lergon Malerei in seinen verschiedenen Arbeiten auf textilen Malgründen als eine Summe verschiedener Komponenten, wobei der narrativ geprägte Farbauftrag in den Hintergrund tritt. Dabei fordern die Materialien selbst ein aktives Handeln des Künstlers ein. Der Prozess des Malens unterliegt ähnlich eingeschränkten Bedingungen wie jene eines Forschers, der im Labor die Parameter eines Versuchs festlegt, der nach ganz bestimmten Regeln durchgeführt werden soll. Die fein abgestimmte Beziehung zwischen der Eigenart des Malmittels und der eigenartigen Beschaffenheit der Oberflächen gewinnt hier zentrale Bedeutung. So wird die „aufgeladene“ Oberfläche zu einem Vehikel für Farbe.
Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass diese scheinbar expressiven Gesten unter kontrollierten Bedingungen ausgeführt werden, die der Künstler als „nicht willkürliche Prozesse“ bezeichnet. Diese Prozesse spiegeln Lergons Strategie der Vermeidung zufälliger Aktionen während des Malens. Seine Arbeitsweise ist nicht rein expressiv, da es definierte Vorbedingungen gibt, die Spontaneität ausschließen. Es mag noch aufschlussreicher sein, diese Beschränkungen als eigentliche „Grenzen“ zu verstehen, als Begrenzung der Bewusstmachung innerhalb einer Aktionsfläche. Diese Grenzen würden dann als Demarkationslinien zwischen bemalten und unbemalten Oberflächen fungieren, die einen Beziehungsraum schaffen, der uns einen von Bewegung bestimmten Prozess beobachten lässt, in dem jedoch zu keiner Zeit die Kontrolle verlorengeht. Dadurch wird die „Summe der einzelnen Komponenten“ – Dichte, Viskosität, Bewegung und Pinselführung – vereint und verleiht so der Arbeit ihre Identität.
Wenn es die räumliche Anordnung der weißen Bilder erlaubt, einen „Eigenraum“ mit Ausrichtung auf den Betrachter zu schaffen und die angewandten Parameter (wie die Einschränkungen durch das festgelegte Bildformat) helfen, den Malprozess zu bestimmen, auf welche Weise ändern sich dann die Regeln, wenn dieselben Prinzipien direkt auf die Wände des Ausstellungsraums übertragen werden, wie es in der Arbeit im Erdgeschoss des Kunstvereins geschehen ist? Hier fehlen die physischen Grenzen des Formats, mit denen auf mögliche Zufälle in der Zeichensetzung reagiert werden kann. Lergon versteht die Wandarbeiten unter anderem in einem gravitativen Sinne, wobei er ihnen ein innewohnendes Gewicht zuschreibt. Für den Künstler haben Maßstab und horizontaler Malverlauf der Arbeiten aus Metallpulver Einfluss auf die Raumarchitektur selbst. Diese dynamischen Kompositionen „krümmen“ den Innenraum fast auf eine dem eigentlichen „Eigenraum“ ähnliche Weise, durch die lineare Transformation eines Vektorraums nämlich, unter Einbeziehung von Dehnung und Kompression. Auch die Beziehung zwischen der Beschaffenheit des Malmaterials und jener der Oberfläche entwickelt sich weiter. Im Gegensatz zu dem textilen Malgrund, dessen Oberfläche formatiert, vorbearbeitet und auf das aufzutragede Malmaterial ausgerichtet ist, erscheint die Wandfläche definitiv neutral, eine für gewöhnlich weiße Oberfläche, die für die Ausstellung frisch gestrichen wurde. Wie ein herkömmliches Gemälde – jedoch ohne dessen Begrenzungen – funktioniert hier die Wandarbeit, die anstrebt Raum zu definieren ohne selbst Volumen zu besitzen. Stattdessen wird Identität hier durch Masse und Körnung des Materials hergestellt , die eine große Dichte vermitteln. Die räumliche Beschaffenheit des Kunstvereins mit seiner besonderen Architektur wird hier zum Grenzgebiet der Aktionsfläche, in der das industrielle Erbe ebenso enthalten ist wie die Spuren sämtlicher bisheriger Ausstellungen. Der Malgrund ist in diesem Fall also in einem sozialen Sinne aufgeladen. Steht man vor dem immensen Schweif aus Eisenpulver, so scheint es fast als habe Lergon die Aktionsfläche auf ihre ursprünglichen Komponenten reduziert – Metall, Bewegung, Masse.
So wie Cassini einen Mond entdeckte, der nur auf einer Seite seiner Umlaufbahn sichtbar war, bringt Daniel Lergon uns das Phänomen des „Gesehenen und Nicht-Gesehenen des Vorhandenen“ durch die Arbeiten der Ausstellung in Mönchengladbach ins Bewusstsein. Der Betrachter kann jeweils nur eine Hemisphäre rezipieren und niemals den Gesamtzusammenhang der Ausstellung. Lergon organsiert seine Arbeiten als Pole einer vertikalen Achse, die die beiden räumlichen Ebenen des Kunstvereins teilt. Am jeweiligen Pol erwarten uns horizontal angeordnete Gemälde. Die dunklen und hellen Töne des Weltraums, ein Ort in dem die Entstehung von Licht durch die Trennung von Strahlung und Materie möglich wurde, werden hier mit ihren Linien und Wellen präsentiert, wobei sie an die Grenzen entfernter Gedanken rühren, die unser Gedächtnis nicht festzuhalten vermag.
Das Sichtbare und das Verborgene, das Strahlende und das Dunkle, die zarte Transparenz des Lacks und die schwere Schmutzspur aus Metallpulver – diese widersprüchlichen Elemente spiegeln die Zwiegestalt des Iapetus. Der Saturnmond bietet durch seine vermeintlich mystische Erscheinung eine Analogie zu vielen Paradoxien in unserem eigenen Lebenskontext. Für Daniel Lergon ist Iapetus ein wirkungsvolles Symbol für die eigentümliche Beschaffenheit von Oberflächen. Durch die Auswahl seiner Malgründe vertieft er die Signifikanz dieses Phänomens, indem er die von der Zeit geprägten Wände des Kunstvereins dem straff gespannten, retroreflexiven Material seiner Bilder gegenüberstellt. So wie die beiden Hemisphären des Iapetus das Sonnenlicht auf unterschiedliche Weise zurückwerfen , reflektieren und modulieren auch die gespannten Oberflächen Lergons weißer, retroreflexiver Arbeiten das Licht. Seine Wandarbeit hingegen scheint dem Raum Licht zu entziehen. Der Eigenraum dieser Arbeit ist dynamisch, gekrümmt, massiv. Die weißen Bilder erzeugen einen intimeren Eigenraum, in dem der Betrachter die Zartheit der Bilder in einem trichterförmigen Raum erlebt, in dem das Licht in umgekehrter Richtung zur Lichtquelle auf ihn zurückgeworfen wird. Fast könnte man in Betrachtung einer der weißen Arbeiten meinen, bei genauem Hinsehen eine vage Andeutung des eigenen, durch Retroreflexion geworfenen Schattens hinter sich auszumachen.
Dass darüber hinaus unser Schatten oder „umbra“ (im ursprünglichen Wortsinn Geist oder Phantom) durch die Präsenz des Lichtes ein Beweis unserer physischen Existenz sein kann, verweist darauf, dass das „Schatten-Selbst“ in seiner Bedeutung unterschätzt wird. Letztlich war es die scheinbare „Abwesenheit“ des Iapetus auf der östlichen Seite des Saturn, die Cassini dazu brachte, genauer hinzuschauen, in die Dunkelheit zu blicken, um dort schließlich den Iapetus in seinem befleckten, staubigen Tarnkleid zu entdecken. Auf ähnliche Weise lenkt der Versuch einer verbalen Beschreibung unser Augenmerk auf das Licht. In diesem Zusammenhang scheint uns unser Begriffskanon uneingeschränkt zur Verfügung zu stehen. Wie aber findet man eine Sprache, die etwas zwischen zwei Polen Fluktuierendes, sich Wandelndes, Uneindeutiges bezeichnen soll? Unsere in einem permanenten Zustand der Bewegung und Entwicklung befindliche Kosmologie zwingt uns, unsere Position, unseren Kontext und unsere Grenzen permanent zu überprüfen, also buchstäblich in die Dunkelheit zu starren. Diese Gleichzeitigkeit von sprachlicher Neuerung und kosmischer Entdeckung bestimmt den Versuch, die Beziehung zu unserer Umgebung zu definieren. Die Tatsache, dass Sprache nicht jeden Zustand beschreiben kann, bedeutet, dass wir gezwungen sind, ihr Potential zu entwickeln. Ebenso zwingen uns die Schatten, blinden Flecken und verdichteten Bereiche im Raum, umfassend und erschöpfend nach vorne zu blicken.
Das Irritierende dieser kosmischen Fragen beschäftigt Lergon insofern als er eine Verbindung zwischen ihnen und dem Verständnis seiner eigenen Arbeit herstellt. Hierbei interessieren den Künstler auch die Unzulänglichkeiten der verbalen Behandlung dieser Fragen. Er sagt, das Wesen seiner Malerei habe kein „verbales Äquivalent“. Da die Arbeiten nicht gänzlich selbstreferentiell sind, erweisen sie sich als nicht völlig abstrakt. Sie sind jedoch auch keinesfalls figurativ. Der Künstler verweigert sich einem simplen Hunger nach Form, indem er die Arbeiten in einer Art Zwischenstadium ansiedelt. Ihre Zwiespältigkeit nährt den Wunsch nach physischen Formen, gleichzeitig entziehen sie sich jedoch einer verbalen Fassbarkeit und bleiben Bilder ohne Entsprechung. Anstatt einen sprachlichen Impuls hervorzurufen, gewinnen Lergons Arbeiten ihre Identität und Stimme durch die Vereinigung verschiedener Komponenten. Durch Viskosität und Pinselführung oder Masse und Dichte wird die Idee des Künstlers von einer „sicheren Ungewissheit“ Schritt für Schritt, aber dennoch unumstößlich manifestiert.
Den Prinzipien der uns umgebenden Galaxie entsprechend umkreist das Reich des Iapetus unsere Fantasie, wirft jedoch wie jede Entdeckung im Kosmos Fragen nach Licht und Form und den unendlichen Ausmaßen unseres Universums auf. Der Blick öffnet sich auf eine Welt der Zukunft, in der bereits verloschenes Licht uns erreichen wird, um erst dann unsere Gegenwart zu beleuchten. Die Sprache, mit der wir unsere Ursprünge zu beschreiben suchen, wird an ihre Grenzen stoßen, zerfallend und gleichzeitig sich entwickelnd, um unsere Entdeckungen zu bezeichnen und unserer Wirklichkeit einen Sinn zu verleihen. Wir betrachten Daniel Lergons Arbeiten, um uns innewohnende Formen aus dem untergründigen Geflecht des Unbewussten hervorzurufen, sie intuitiv emporzuheben und im Rahmen seiner Arbeiten erstehen zu lassen. In der Betrachtung der hier ausgestellten Werke betreten wir den Grenzbereich zwischen Licht und Materie.
Übersetzung: Stephanie Rupp